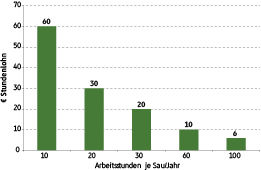Bioferkel: Eigene Leistungszahlen zeigen wirtschaftlichen Spielraum

Die wirtschaftliche Grundlage
legt man mit tragbaren Fixkosten,
einem überschaubaren Arbeitsaufwand
und einer guten biologischen
Leistung.
Ein durchschnittlicher Bioferkelproduzent
verkauft knapp 17 Ferkel
je Sau und Jahr und erwirtschaftet
damit rund 1.300 Euro
Direktkostenfreie Leistung (DfL)
bei aktuellen Marktpreisen und
nach Abzug der Direktkosten für
zum Beispiel Futter, Tiergesundheit,
Bestandsergänzung und
Decken. Die Direktkostenfreie
Leistung muss die Fixkosten, wie
Stallgebäude und fixe Maschinenkosten
begleichen sowie die
Arbeitsentlohnung finanzieren.
Stallplatzkosten bei Neubauten
um rund 9.000 Euro je Sauenplatz
belasten die Direktkosten
freie Leistung erheblich.
Wann ist Stall abbezahlt?
Entnimmt ein Durchschnittsbetrieb
A von der Direktkostenfreien
Leistung (rund 1.300 Euro)
beispielsweise 600 Euro je Sau
und Jahr als Arbeitsentlohnung,
kann dieser bei vollständiger Fremdfinanzierung in zirka 18
Jahren den Stall abbezahlen. Betrieb
B kann beim selben Lohnansatz
mit einer höheren Direktkosten
freien Leistung von 1.550
Euro, was zirka 19 verkauften
Ferkeln entspricht, den Stall in
knapp zwölf Jahren begleichen.
Für Betrieb C mit 15 verkauften
Ferkeln und einer Direktkosten
freien Leistung von nur 1.050
Euro wäre der Neubau erst nach
38 Jahren abgeschrieben und damit
ökonomisch kaum rentabel.
Eigene Ansprüche und ansprechender Stundenlohn
Alternativ kann sich Betrieb C in
seiner Entlohnung zurücknehmen
und Betrieb B kann einen höheren
Lohn aus der Schweinehaltung
entnehmen. Wie viel Lohnansatz
man sich zugesteht, hängt
von den eigenen Ansprüchen
ab und von den zu leistenden
Arbeitsstunden je Sau und Jahr,
für die ein ansprechender Stundenlohn
gewährleistet sein soll. Das Beispiel zeigt den großen
Einfluss der biologischen Leistung
auf den ökonomischen Erfolg
eines Betriebszweigs. Leistung
kommt allerdings nicht automatisch
durch einen Stallneubau.
Bei Kostenplanung auf Leistungszahlen achten
Wer neu baut, soll deshalb in der
Kostenplanung keine Leistungszahlen
ansetzen, die stark vom
Durchschnitt abweichen. Neueinsteiger
hadern in den ersten Jahren
oft mit den Herausforderungen
der Produktionsform. Nach
ersten erfolgreichen Jahren im
neuen Stall werden manche von
sich aufbauenden Schwierigkeiten,
wie dem steigenden Keimdruck
und einer alternden Sauenherde,
auf den Boden der Realität
zurückgeholt. Betriebe mit alten
Ställen hinterfragen niedrige Leistungen
oft nicht mehr. Nichtsdestotrotz
verkaufen Spitzenbetriebe
auch im langjährigen Durchschnitt
zwischen 20 und 22 Ferkel
je Sau und Jahr.
Ein teurer Stall sollte dabei helfen,
Arbeitszeit einzusparen. 600
Euro Lohnansatz entsprechen bei
30 Arbeitsstunden je Sau und Jahr
etwa 20 Euro Stundenlohn. Benötigt
man für dieselbe Leistung nur
15 Stunden, liegt man bei 40 Euro
Stundenlohn. Bei 60 Stunden je
Sau und Jahr wird eine Stunde jedoch
mit nur 10 Euro entlohnt
(siehe Grafik).
Beim Neubau keine "Schnellschüsse" abgeben
1.000 Euro höhere Stallplatzkosten
entsprechen bei 20 Jahren Abschreibungszeit
etwa 73,5 Euro
Mehrkosten je Sau und Jahr. Es
sollten also entsprechend drei bis
vier Stunden Arbeit je Sau und
Jahr eingespart werden können.
Bei einem Bestand von 20 Sauen
entspricht das einer Arbeitszeit
von 11,5 Minuten pro Tag. Deshalb
sollte man bei einem Neubau
keine "Schnellschüsse" abgeben,
penibel auf bauliche Details achten,
Beratung in Anspruch nehmen
und stets hinterfragen, welche
Investitionen wirklich notwendig
sind.
Andernfalls kann man an der
überbordenden Arbeitszeit oder
den nicht erreichbaren Leistungszielen
verzweifeln. Im besten Fall mündet mehr Arbeitszeit in einer
besseren Leistung. Mit durchschnittlich
8,4 abgesetzten Ferkeln
je Wurf und Saugferkelverlusten
jenseits der 20% ist
diese in der Bioferkelproduktion
auf vielen Betrieben durchaus
ausbaufähig, besonders, wenn
man das Potenzial der gesamtgeborenen
Ferkel mit 13 Ferkeln
und mehr je Wurf betrachtet. Hier
stehen Biobetriebe den konventionellen
Berufskollegen kaum
nach. Die entsprechend hohe Anzahl
geborener Ferkel ist nicht immer
gewünscht, da die Verluste mit
höheren Geburtszahlen entsprechend
steigen. Ein zusätzlich verkauftes
Ferkel mehr je Wurf bedeutet
zirka 2,08 Ferkel je Sau und Jahr,
sowie nach Abzug der Futterkosten
265 Euro höhere Direktkostenfreie
Leistung. Das entspricht zirka dem
Unterschied zwischen Betrieb A
und B sowie A und C.
Potenzial rund um Geburt und ums Absetzen
Gleichzusetzen ist diese Leistungssteigerung
auch mit dem Absenken
der Totgeborenen sowie der
Saugferkel- und Absetzverluste um
7%. Besonders in den
ersten Tagen nach der Geburt und
rund ums Absetzen gibt es in den
meisten Betrieben noch einiges
Potenzial, sei es bei der Geburtsbeobachtung,
der Mütterlichkeit der
Sauen oder dem Management und
der Fütterung.
Einfluss der Zwischenwurfzeit
Die verkauften Ferkel können allerdings
auch über die Anzahl
der Würfe je Sau und Jahr erhöht
werden. Diese hängt von der Zwischenwurfzeit
und damit zu allererst
von der Säugezeit sowie den
Umrauschern ab. Viele Betriebe
verlängern die Säugezeit bewusst
über die 40 Tage Mindestsäugezeit
hinaus, um weniger Probleme
beim Absetzen zu haben. Der
Durchschnitt der Betriebe liegt bei
etwa 46 Tagen. Eine Woche Säugezeit
entspricht 0,08 Würfen beziehungsweise
0,6 bis 0,7 Ferkeln sowie
70 bis 85 Euro je Sau und Jahr.
Niedrige Umrauscherquote
Auf alle Fälle macht es Sinn, die
Zwischenwurfzeit durch eine niedrige
Umrauschquote zu senken.
Der Erfahrung nach werden umrauschende
Sauen in den seltensten
Fällen direkt drei Wochen nach
der ersten Belegung wieder gedeckt.
Sauenplanerauswertungen
zeigen, dass dies im Durchschnitt
eher erst nach 50 bis 60 Tagen geschieht.
10% mehr oder
weniger Umrauscher haben in diesem
Fall ähnliche ökonomische
Auswirkungen wie eine Änderung
der Säugezeit um sieben Tage. Mit
unter 13% Umrauschern liegen
die meisten Biobetriebe auf
einem ansprechenden Niveau.
Leistungszahlen im eigenen Stall ermitteln
Um einschätzen zu können, in
welchen Bereichen am Betrieb es
noch ökonomischen Spielraum
gibt, muss man zumindest die
eigenen Leistungszahlen kennen.
Hilfe bieten diverse Sauenplaner
und andere Managementtools.
Handschriftliche Aufzeichnungen
und Wurfblätter helfen zwar, geben
aber ohne genaue Auswertung
nur einen ungefähren Überblick,
da der Einfluss von Ausreißern auf
den Betriebsdurchschnitt schwer
abgeschätzt werden kann. Ein Abort
im Jahr bei einem Sauenbestand
von 20 Tieren bedeutet beispielsweise
zirka 0,5 Ferkel je Sau
und Jahr weniger.
Wesentlich lieber als die eigene
Leistung werden die Marktpreise
hinterfragt. Eine Preissteigerung
der Ferkelnotierung um 30 Cent
entspricht beispielsweise einer höheren
Direktkosten freien Leistung
von 143,5 Euro.
Natürlich ist der einfachste Weg
Preissteigerungen zu fordern, allerdings
hat man als Betriebsleiter
nur relativ geringen Einfluss auf
das Marktgeschehen.
Grundsätzliche Probleme beseitigen
In der eigenen Hand liegen hingegen
die Stellschrauben der Leistung
und zum überwiegenden
Teil jene der Kosten. Allerdings macht es keinen Sinn, an den kleinen
Schrauben herumzudrehen,
bevor man nicht grundsätzliche
Probleme beseitigt. Hat man die
Schwachstellen am Betrieb entdeckt,
ist der nächste Schritt, herauszufinden, wodurch die Probleme
verursacht werden, um sich zu
überlegen, wie man diese beseitigt.
Um Betriebsblindheit hintanzuhalten,
emp fiehlt sich immer die
Beratung durch externe Experten,
seien es Berufskollegen, wie zum
Beispiel im Arbeitskreis Bioferkelproduktion,
Tierärzte oder Berater
der Erzeugerorganisationen, Verbände
sowie Kammern. Leistungsstarke
Betriebe, die sich immer
wieder selbst hinterfragen, verdienen auch in schwierigen Marktzeiten
zumeist noch gutes Geld.
Teilnahme empfohlen
Bioschweinehaltern sei auf
alle Fälle empfohlen, an
der ÖPUL-Maßnahme "Tierschutz-Stallhaltung" teilzunehmen.
Sie erfüllen die Anforderungen
automatisch, wenn sie
die Biorichtlinien einhalten.
Ein letztmaliger Einstieg ist
mit dem Herbstantrag 2019 möglich
und bringt rund 40 Euro je
Sauenplatz. Man kann jährlich
aus der Maßnahme wieder
aussteigen.